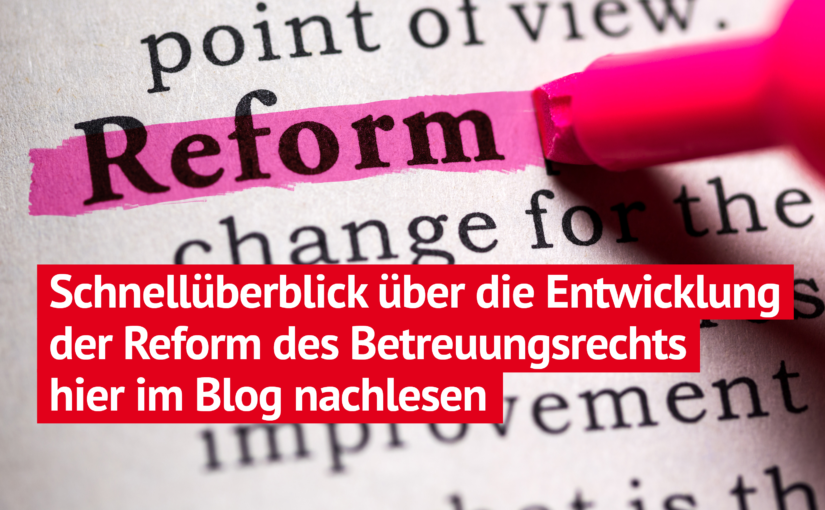Am 1. Januar 2023 ist es soweit – die Reform des Betreuungsrechts tritt in Kraft. Der Weg zu dieser Novelle war lang. Hier ein Überblick über den Gang der Gesetzgebung:
12.05.2021 – Verkündung im Bundesgesetzblatt
Das Gesetz wurde am 12.05.2021 im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt ab 01.01.2023 in Kraft.
26.03.2021 – Gesetz passiert den Bundesrat
Der Bundesrat hat am 26.03.2021 der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zugestimmt. Das Gesetz kann nun im Bundesgesetzblatt verkündet werden und tritt dann am 01.01.2023 in Kraft.
Schwerpunkte der Änderungen:
Selbstbestimmtes Handeln
Die Reform stellt klar, dass die rechtliche Betreuung in erster Linie eine Hilfe bei der Besorgung der eigenen Angelegenheiten durch eigenes selbstbestimmtes Handeln ermöglicht und dass Betreuer nur als Stellvertreter auftreten dürfen, soweit es erforderlich ist.
Der Vorrang der Wünsche des Betreuten ist künftig zentraler Maßstab für das Betreuerhandeln, die Eignung des Betreuers und die gerichtliche Aufsicht. Die betroffene Person soll besser informiert und stärker eingebunden, Pflichtwidrigkeiten des Betreuers besser erkannt und sanktioniert werden.
Unterstützung für Ehrenamtliche
Ehrenamtliche Betreuer erhalten durch die Reform mehr Informationen und Kenntnisse – auch durch enge Anbindung an einen anerkannten Betreuungsverein. Wenn sie keine familiären Beziehungen oder persönlichen Bindungen zum Betreuten haben, sollen sie mit einem solchen Verein eine Vereinbarung über eine Begleitung und Unterstützung abschließen.
Förderung von Betreuungsvereinen
Anerkannte Betreuungsvereine haben Anspruch auf eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln. Dies soll eine verlässliche öffentliche Förderung durch Länder und Gemeinden sicherstellen, die das gesamte Aufgabenspektrum umfasst und für die Betreuungsvereine Planungssicherheit schafft.
Ehegattenvertretung im Krankheitsfall
Ein neues Registrierungsverfahren mit Mindesteignungsvoraussetzungen für berufliche Betreuer gewährleistet einheitliche Qualität. Die Vermögensverwaltung durch Betreuer und Vormünder wird modernisiert und grundsätzlich bargeldlos erfolgen. Schließlich können Ehegatten einander in Gesundheitsangelegenheiten kraft Gesetzes für die Dauer von sechs Monaten gegenseitig vertreten, wenn sich ein Ehegatte krankheitsbedingt vorübergehend nicht um seine Angelegenheiten kümmern kann.
05.03.2021 – 2. und 3. Lesung im Bundestag
Am 05.03.2021 fand die 2. und 3. Lesung im Bundestag statt. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung (Drs. 19/24445) wurde zusammen mit der Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz vom 03.03.2021 (Drs. 19/27287) verabschiedet. Das Gesetz muss nun noch den Bundesrat passieren.
26.11.2020 – 1. Lesung im Bundestag
Am 26.11.2020 fand die erste Lesung des Gesetzesentwurfs (Drs. 19/24445) im Bundestag statt. Es erfolgte danach eine Überweisung in die Ausschüsse.
23.09.2020 – Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts
Am 23.09.2020 hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf gebilligt. Er wird nun in Bundestag und Bundesrat eingebracht.
Dem voraus ging das Einholen von Stellungnahmen der Verbände und von Sachverständigen. Die Liste dieser Stellungnahmen ist auf der Homepage des Bundesministeriums der Justiz zu finden: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Reform_Betreuungsrecht_Vormundschaft.html
23.06.2020 – Referentenentwurf „Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts“ liegt vor
Am 23.06.2020 wurde der fast 500 Seiten starke Referentenentwurf an die Bundesländer und die Fachverbände mit der Bitte um Stellungnahme geschickt.
Der Gesetzentwurf kann hier abgerufen werden: www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Vormundschaft_Betreuungsrecht.html
Eine Zusammenfassung wichtiger geplanter Neuerungen finden Sie in diesem Beitrag: Reform des Betreuungsrechts kommt
12.09.2018 – 2. Diskussionsteilentwurf zur Reform des Vormundschaftsrechts (Neustrukturierung §§ 1721-1921 BGB) liegt vor
Seit Mitte September 2018 liegt ein zweiter Diskussionsteilentwurf zur Modernisierung des Vormundschaftsrechts vor. In diesem Entwurf wird auch der Gesetzesaufbau sowohl des Vormundschaftsrechts als auch des Betreuungs- und Pflegschaftsrecht überarbeitet.
Wesentliche inhaltliche Neuerungen das Betreuungsrecht betreffen die Vorschriften
- zur Vermögenssorge,
- zur Aufsicht des Gerichts,
- zum Aufwendungsersatz und zur Vergütungspflicht
Sie werden künftig unmittelbar im Betreuungsrecht eingeordnet und die Vorschriften soweit erforderlich an die Vorgaben des Betreuungsrechts angepasst. Die Vergütung selbst bleibt im VBVG geregelt, das in seiner Grundstruktur unverändert bleibt – mit Ausnahme der Neuregelungen zur Vergütung des Vereinsvormunds.
20.06.2018 – Auftaktsitzung im BMJV und Bildung von Arbeitsgruppen
Am 20. Juni 2018 wurde der Diskussionsprozess „Selbstbestimmung und Qualität im Betreuungsrecht“ im Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) gestartet. Zur Auftaktsitzung eines interdisziplinär besetzten Plenums waren rund 80 Experten aus Wissenschaft, den kommunalen Spitzenverbänden und aus den Bundesländern sowie Vertreter von Verbänden (Behindertenverbände, Berufsverbände, Betreuungsgerichtstag e.V.) eingeladen.
Ziel des Prozesses laut Pressemitteilung des BMJV: Durch Änderungen im Betreuungsrecht soll die Qualität der rechtlichen Betreuung durch Stärkung des Selbstbestimmungsrechts verbessert und gleichzeitig sichergestellt werden, dass rechtliche Betreuung nur dann angeordnet wird, wenn sie zum Schutz der Betroffenen erforderlich ist.
Folgende Arbeitsgruppen wurden zur Beareitung unterschiedliche Felder gebildet:
- Betreuung als Beruf und die Vergütung des Berufsbetreuers
- Ehrenamt (einschl. Verbesserung der finanziellen Situation der Betreuungsvereine) und Vorsorgevollmacht
- Rechtliche Betreuung und „andere Hilfen“ (Schnittstelle zwischen rechtlicher und sozialer Betreuung)
- Stärkung des Selbstbestimmungsrechts des Betreuten bei der Betreuerauswahl, der Betreuungsführung und der Aufsicht
Ende 2019 sollen die Ergebnisse fest stehen und entsprechende Gesetzgebungsvorschläge auf den Weg gebracht werden.
06./07.06.2018 – Beschluss der Justizministerkonferenz
Am 6. und 7. Juli 2018 fand die Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und Justizminister der Länder (JUMIKO) statt, auf der auch Reformbestrebungen bezüglich des Betreuungsrechts auf der Tagesordnung stand. Behandelt wurden insbesondere strukturelle Änderungen an der Schnittstelle zum Sozialrecht und eine qualitätsorientierte Anpassung der Betreuervergütung.
In ihrem Beschluss wies die JUMIKO darauf hin, dass die Reformdebatte über das Betreuungswesen nachhaltig fortgeführt werden müsste. Die Ergebnisse der Forschungsvorhaben müssten dabei hinterfragt werden. Im Rahmen dieses Prozesses sollten insbesondere die im Bereich des Erforderlichkeitsgrundsatzes, der Betreuungsqualität und der Vergütung gezeigten Defizite angegangen und behoben werden.
Ziel dieser Debatte sollte insbesondere darin bestehen,
- das grundrechtlich und durch die UN-Behindertenrechtskonvention abgesicherte Selbstbestimmungsrecht der hilfebedürftigen Menschen zu stärken; ausschließlich soziale Hilfeleistung erfordernde Sachverhalte dürfen nicht mehr systemwidrig Ursache von Betreuerbestellungen werden,
- dass eine Betreuerbestellung daher als „ultima ratio“ erst dann erfolgt, wenn andere Hilfen nicht greifen,
- dass sich die Justiz auf ihre Kernaufgaben konzentriert,
- die Position der Betreuungsbehörde strukturell (innerhalb und außerhalb des gerichtlichen Verfahrens) weiter zu stärken,
- die Betreuungsvereine als wesentliche Träger der Querschnittsarbeit und wichtiges Bindeglied zu den Ehrenamtlichen im Bereich der Betreuung und Vorsorgevollmacht zu stärken,
- dass auch eine zeitnahe Vergütungsanpassung qualitätsorientiert erfolgen muss und nicht isoliert von der laufenden Strukturdebatte erfolgen darf.
Diese Zielsetzung ist entommen aus dem Beschluss der Justizministerkonferenz:
09.04.2018 – Abschluss der vom BMJV beauftragten Forschungsvorhaben
Zwei Jahre lang – von November 2015 bis November 2017 – führe das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik in Kooperation mit der Technischen Hochschule Köln das Forschungsvorhaben „Qualität in der rechtlichen Betreuung“ durch. In Auftrag gegeben wurde dieses vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV). Das BMJV hat am 9. April 2018 den vollständigen Abschlussbericht veröffentlicht:
Die IGES Institut GmbH Berlin war Ende 2015 mit der Durchführung des Forschungsvorhabens zur „Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes in der betreuungsrechtlichen Praxis im Hinblick auf vorgelagerte „andere Hilfen“ beauftragt worden. Zu berücksichtigen war hier insbesondere das am 1. Juli 2014 in Kraft getretenen „Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde“. Auch dieser Abschlussbericht wurde am 9. April 2018 veröffentlicht.
Forschungsbericht: Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes in der betreuungsrechtlichen Praxis im Hinblick auf vorgelagerte ‚andere Hilfen‘