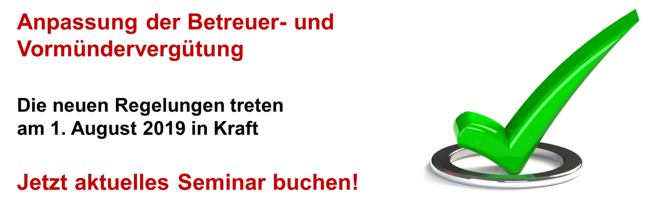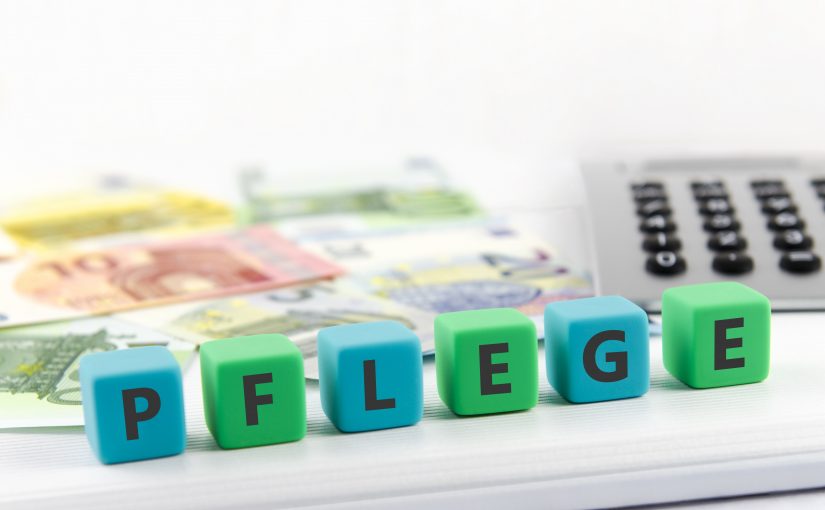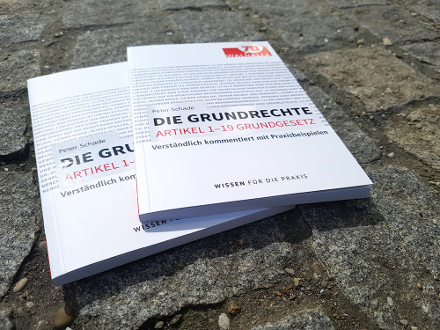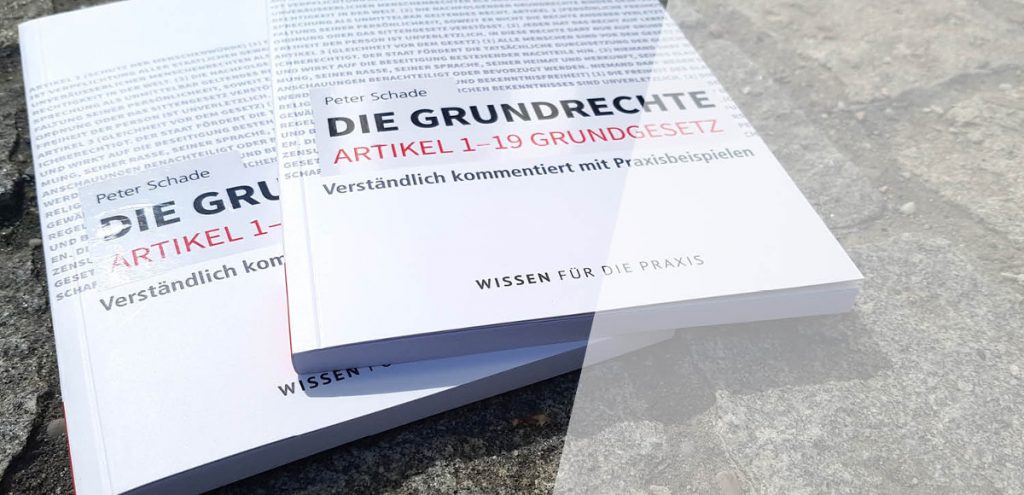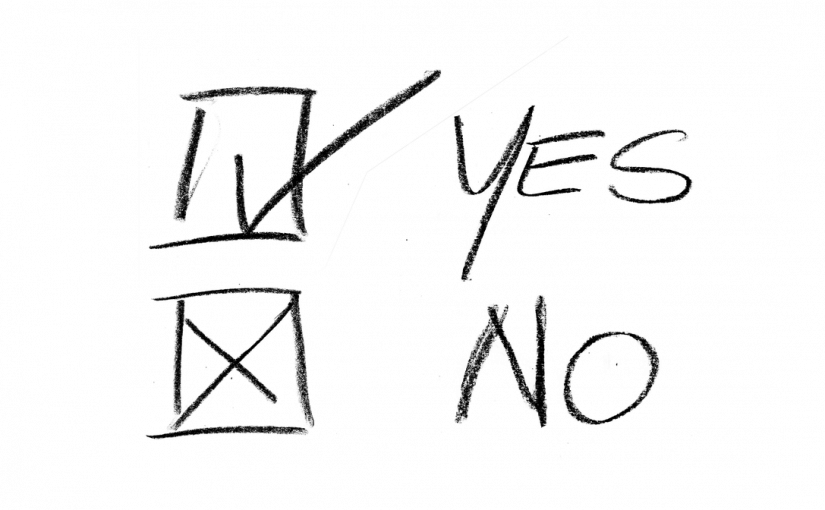Ein Mensch mit Behinderung, der heute in sogenanten Stationären Einrichtungen („Wohnheimen“) lebt, wohnt ab 2020, ohne dass er umziehen muss, in höchst unterschiedlichen „Gebilden“. Je nach dem, von welchem Gesetz aus man das betrachtet.
- SGB IX:
In der Eingliederungshilfe lebt er nun in einer besondere Wohnform, in der Leistungen über Tag und Nacht erbracht werden (§ 115 SGB IX).
- SGB XII:
In der Grundsicherung lebt er in einer Räumlichkeit, bei dem ihm ein persönlicher Wohnraum zur Verfügung steht und er weitere Räume gemeinsam mit anderen Personen nutzen kann (§ 42a SGB XII).
- SGB IX:
In der Pflegeversicherung lebt er weiter in einer „stationäre Einrichtung der sozialen Teilhabe“. (§ 71 Abs.4 SGB XI Fassung ab 1.1.2020). Die Aufwendungen der Pflegekasse für Pflegeleistungen dürfen hier im Einzelfall je Kalendermonat 266 Euro nicht überschreiten.
Deckelung von Pflegeleistungen
Wichtig bei dem letzten Punkt ist die Regelung, dass, wenn außerhalb einer vollstationären Einrichtung ein vollstationäres Leistungsangebot gemacht wird, diese als „Räumlichkeiten“ den stationären Einrichtungen zugeordnet werden (§ 71 Abs.4 Nr.3 SGB XI).
Das bedeutet, dass der Deckelungsbetrag von 266 Euro für Pflegeleitungen unter Umständen auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf gilt, die nach allgemeinem Verständnis nicht in einer stationären Einrichtung leben, sondern vielleicht in einer Betreuten Wohngruppe, wenn die Gesamtversorgung regelmäßig einen Umfang erreicht, der weitgehend der Versorgung in einer vollstationären Einrichtung entspricht.
Eine weitere Voraussetzung für die Deckelung der Pflegeleitung ist, dass es sich um eine trägerverantwortete betreute Wohngemeinschaft handelt, bei der Vertrag über das Wohnen und über die Leistungen miteinander verknüpft ist, die Wohngemeinschaft also in den Anwendungsbereich des WBVG (Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz) fällt.
Strittig ist, wie hoch der Umfang der Leistungen sein muss, damit die Wohnung des Betroffenen den stationären Einrichtungen im Sinne des SGB XI zugeordnet werden kann.
Entwurf einer Richtlinie
Der GKV Spitzenverband hat den Entwurf der Richtlinien zur Abgrenzung stationärer Einrichtungen von anderen Räumlichkeiten i. S. d. § 71 Abs. 4 Nr. 3 SGB XI vorgelegt. Die Verbände haben die Möglichkeit, eine Stellungnahme bis zum 7. Juni 2019 abzugeben.
Danach werden die Räumlichkeiten einer stationären Einrchtung gleichgestellt, wenn der Umfang einer anbietergestützten Gesamtversorgung typischerweise einer stationären Versorgung entspricht. Der Umfang ist dann erreicht, wenn durch einen oder mehrere Leistungserbringer eine umfassende Deckung des Bedarfs des in den Räumlichkeiten wohnenden Menschen mit Behinderungen erfolgt. Hiervon ist auszugehen, wenn durch den oder die Leistungserbringer Unterkunft und Verpflegung, Leistungen der Eingliederungshilfe sowie Pflege- und Betreuungsleistungen sowie die räumliche und sächliche Ausstattung zur Verfügung gestellt werden.
Alternative
Eine Möglichkeit, dem ganzen Prozedere zu entgehen, wäre es, die Verknüpfung von Wohnen und Betreuungsleistung aufzugeben, so dass das WBVG nicht mehr anwendbar ist. Da die beiden oben genannten Kriterien kumulativ vorliegen müssen, kommt es dann auf den Umfang der Betreuungsleistungen überhaupt nicht mehr an. Den Bewohner*innen müssten also Mietverträge und Betreuungsverträge angeboten werden, die auch tatsächlich nicht voneinander abhängig sein dürfen. Die Bewohner*innen müssen, jedenfalls gemeinschaftlich, rechtlich und tatsächlich in der Lage sein, die Leistungserbringer frei zu wählen und auch zu wechseln.
Die gesetzliche Regelung erweist sich hier als problematisch, da sie in Einzelfällen den „Status“ einer Wohneinrichtung von einem unbestimmten und schwer kontrollierbaren Merkmal – tatsächliche Abhängigkeit der beiden Verträge voneinander – abhängig macht.
Quellen: Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes, DPWV – Handreichung
Fotolia_99094355_Subscription_XXL.jpg